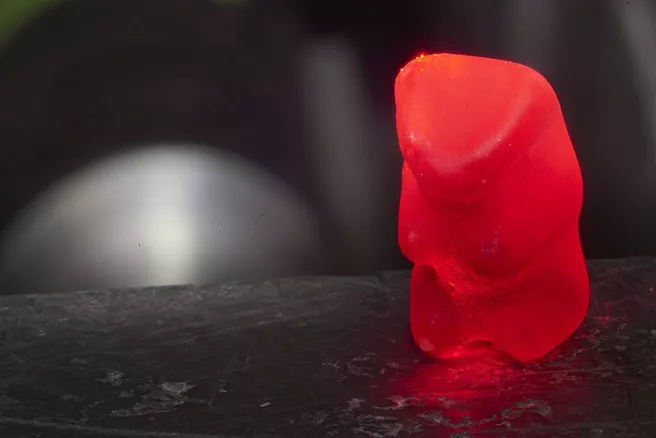03.12.2014
Vertrocknete Gummibärchen sind nicht unbedingt jedermanns Geschmack. Auch Antimaterie, genauer gesagt Positroniumatome, scheinen sich in trockenen Gummibärchen nicht so wohl zu fühlen. Sie zerstrahlen nämlich sehr viel schneller als in gewässertem Gelatinezuckergemisch: Statt nach 1,9 bereits nach 1,2 Nanosekunden. Das haben jetzt zwei Physiker der Technischen Universität München experimentell nachgewiesen und beeinflussen damit die Entwicklung von Umhüllungen für Arzneimittel.
PD Dr. Christoph Hugenschmidt und Hubert Ceeh beschossen rote Gummibärchen verschiedenster Trockenstadien mit Positronen, den Antiteilchen der Elektronen. Positronen können in kleiner Menge im Labor (für diesen Versuch) oder in großer Menge an der Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) der TU München hergestellt werden. In den Gummibärchen bildet sich aus dem Positron und einem Elektron ein exotisches Atom, das Positronium genannt wird. Das Positronium verfängt sich in winzigsten Poren der Gummibärchen, sogenannten Nanoporen. Je kleiner diese Nanopore ist, desto kürzer lebt das Positronium. Mit der Lebensdauer des Positroniums konnten die Physiker also gleichzeitig auch das Volumen der Nanoporen in dem Gelatinezuckergemisch bestimmen.
Natürlich geht es den beiden Physikern nicht primär um Gummibärchen. Vielmehr ist die Süßigkeit ein Modellsystem für Biopolymere, die vor allem aus Gelatine und Glukose bestehen. Gelatine wird maßgeschneidert in großem Umfang in der Pharmazie eingesetzt, um etwa Pillen zu ummanteln. Die Anforderung: Die Hülle soll einerseits mechanisch stabil sein und den Wirkstoff vor Oxidation schützen, andererseits sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im Magen auflösen und den Wirkstoff freisetzen. Zur zielgenauen Entwicklung solcher Biopolymere spielt die Charakterisierung des freien Volumens eine herausragende Rolle. Und hier kommt die Antimaterie ins Spiel: „Mit Positronen als hochmobilen Sonden lässt sich das Volumen der Nanoporen gerade auch in ungeordneten Systemen wie vernetzter Gelatine bestimmen“, so Hugenschmidt. „Je größer das freie Volumen, desto eher kann Sauerstoff eindringen und den Wirkstoff schädigen, aber auch desto weniger spröde ist die Gelatine.“ So tragen zerstörungsfreie Antiteilchenmessungen an Gummibärchen dazu bei, verträgliche und maßgeschneiderte Gelatinekapseln zu entwickeln.
Publikation:
The Free Volume in Dried and H2O‑Loaded Biopolymers Studied by Positron Lifetime Measurements
Christoph Hugenschmidt and Hubert Ceeh, Journal of Physical Chemistry B
DOI: 10.1021/jp504504p
Weblink:
http://www.sces.ph.tum.de/research/positron-physics/