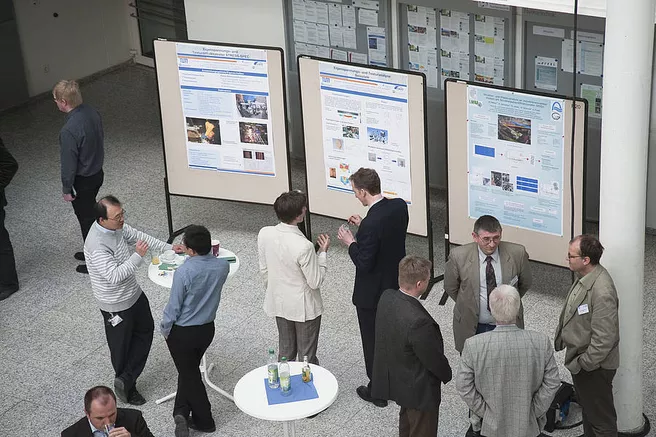In sieben Vorträgen, die Dr. habil. Ralph Gilles vom FRM II mit Unterstützung von Dr. Rainer Schneider (VDI / VDE-IT GmbH) sowie Thomas Ullmann organisiert (DLR) hatte, ging es um „Zerstörungsfreie Prüfung an Industriebauteilen – vom Ultraschall bis zu den Neutronen“. Nach der Begrüßung und einer kurzen Einführung durch den Stellvertretenden Wissenschaftlichen Direktor des FRM II, Dr. Jürgen Neuhaus, präsentierte Inga Wehmeyer vom Ford Forschungszentrum ihre Ergebnisse zum Klebstofffüllgrad im Automobilbau, die sie mit unterschiedlichen zerstörungsfreien Methoden gewonnen hatte. Ihr Fazit: Die Analyse mit Neutronen ist von allen Methoden am besten geeignet, da das Kontrastverhältnis und die Darstellung der Fehler hier hervorragend gelingen. Allerdings ist die Neutronenradiographie nicht großserientauglich.
Um die Klebstoffverteilung in 60 Meter langen Flügeln von Windkraftanlagen zu analysieren, setzte Ulrich Bücher von Olympus in Wiesbaden Ultraschalltechnik ein. Er stellte in seinem Vortrag allgemein die Methode der „Ultraschallprüfung an modernen Industriewerkstoffen“ vor. Gegenüber Röntgenstrahlen habe der Ultraschall einen klaren Vorteil: Die Information über die genaue Tiefe einer Fehlstelle im Material wird mitgeliefert.
Weniger die Tiefe als vielmehr die Höhe und damit verbundene Kälte spielte bei den Untersuchungen von Andreas Joos eine Rolle. Für das Institut für Thermofluiddynamik an der TU Hamburg-Harburg maß er das Durchfeuchtungsverhalten in Flugzeugisolierungen an der Radiographiestation des FRM II, ANTARES. Zum ersten Mal wurde bei einem simulierten Langzeitflug so sichtbar, wo genau sich das Wasser aus der Atemluft der Passagiere in der Flugzeugisolierung niederschlägt, wann es gefriert und wieder taut. Simulationsrechnungen der Feuchtigkeitsverteilung der TUHH liefern zudem ganz ähnliche Ergebnisse wie die Neutronenmesssungen.
Auch Matthias Büttner von der Materialprüfungsanstalt der Universität Stuttgart berichtete in seinem Vortrag von einer gute Übereinstimmung zwischen seiner Simulation und der Messung mit Neutronen. Er hatte am Instrument STRESS-SPEC des FRM II eine „Eigenspannungsanalyse von Mischschweißverbindungen dickwandiger Rohrleitungssysteme“ an einem 140 Kilogramm schweren und 600 Millimeter dicken Rohr unternommen. Mischschweißverbindungen weisen sehr inhomogene Nähte auf und werden in sicherheitsrelevanten Rohrleitungen eingesetzt.
Eine andere Methode der zerstörungsfreien Prüfung stellte Prof. Dr. Gerhard Busse vom Institut für Kunststofftechnik an der Universität Stuttgart vor: die Lock-In-Thermografie. Über Lampen wird die Probe erwärmt, die zurückgestrahlte Wärme wiederum wird von einer Infrarotkamera eingefangen und in Bilddaten umgewandelt. Je nach Frequenz der Einstrahlung sind auch Aufnahmen in größeren Tiefen von Bauteilen möglich. Als eine spezielle Weiterentwicklung stellte Prof. Busse die Ultraschall-Lock-In-Thermografie vor. Sie hat allerdings nur eine Tiefenreichweite bis zu 8 Millimetern.
Nach den Vormittagsvorträgen und einem Mittagsimbiss nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit zur Diskussion mit den Vertretern des FRM II, die an einem Dutzend Postern industrielle Anwendungen vorstellten.
Wie es um die Validierung von innovativen zerstörungsfreien Prüfmethoden steht, erläuterte Dr. Bernd Valeske vom Fraunhofer Institut für zerstörungsfreie Prüfung in Saarbrücken im Anschluss an die Posterpräsentation. Nicht nur die Gerätetechnik muss überprüft werden, um zu bestätigen, dass die Methode zur Analyse ausreichend ist, sondern auch das Personal muss entsprechend qualifiziert werden.
Gezielt Fehler produzierte Bodo Gudehus vom Wehrwissenschaftlichen Institut in elektronischen Bauteilen. Er untersuchte, wie Neutronen in Metalloxidhalbleitern die Fehlerhäufigkeit in der Elektronik beeinflussen. Dazu testete er ein Dutzend handelsüblicher Bauelemente unter dem Einfluss von schnellen Neutronen am Instrument NECTAR des FRM II und mit langsamen Neutronen am Instrument ANTARES. Gudehus fand heraus, dass die Fehlerrate linear mit der Bestrahlungszeit stieg und schnelle Neutronen mehr Fehler erzeugten als langsamere.
Die Teilnehmer hatten bereits nach den jeweiligen Vorträgen die Zeit für Fragen intensiv genutzt, aber auch nach dem letzten Vortrag beteiligten sie sich rege an der Podiumsdiskussion mit den Referenten. Prof. Dr. Heinz Voggenreiter vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt leitete die Diskussion, die vor allem zeigte: Die zerstörungsfreie Prüfung ist für die Wissenschaft ein interessantes Gebiet, um sich weiter zu entwickeln und neue Forschungsprojekte anzustoßen, und für die Industrie bietet sie ein Portfolio an Methoden, um Bauteile zu analysieren.
Im Anschluss an die Veranstaltung nutzten viele Teilnehmer die Gelegenheit zur Besichtigung der Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II). Hier konnten sie den Wissenschaftlern an den Geräten gezielt Fragen zu ihren Projekten stellen.
Weitere Bilder der Veranstaltung